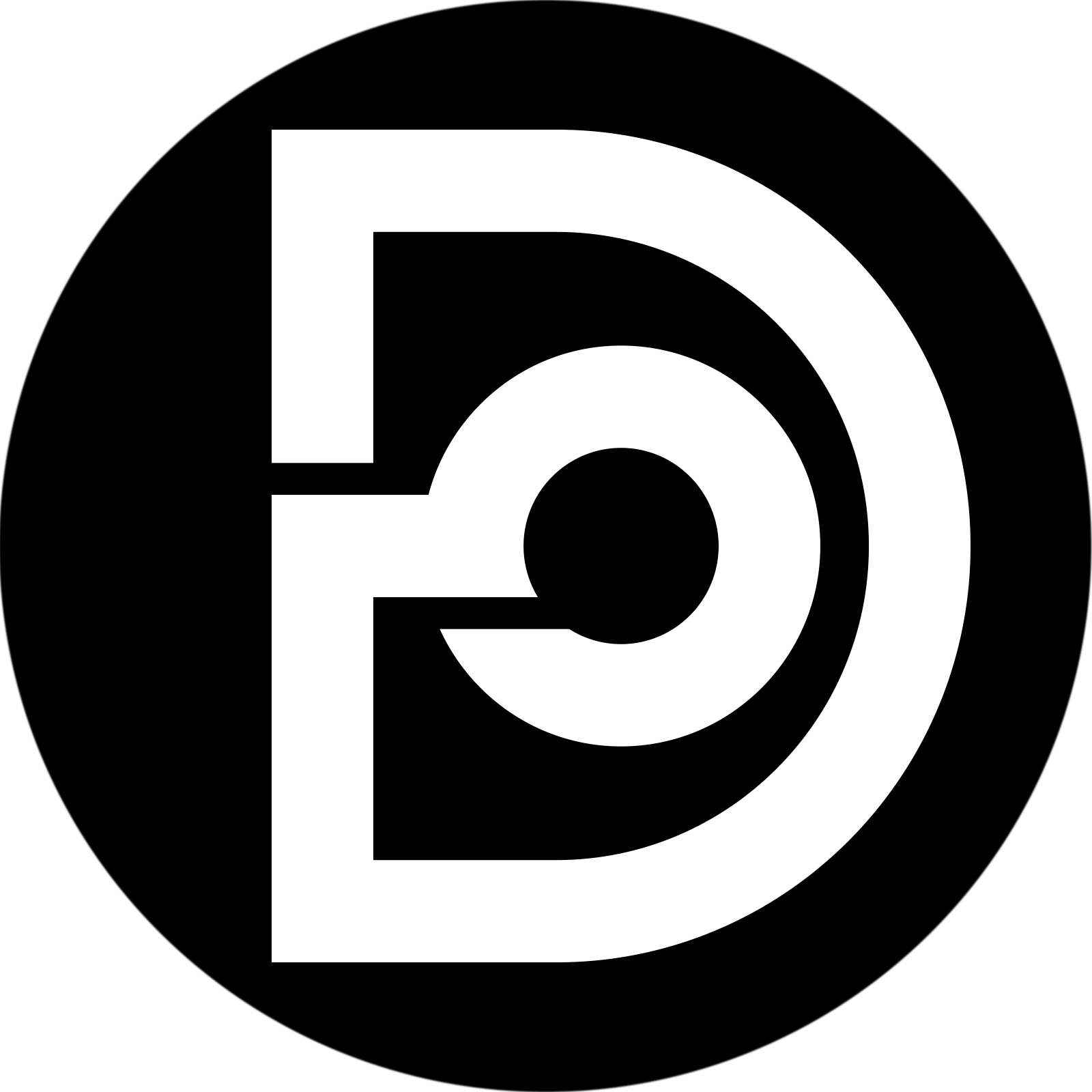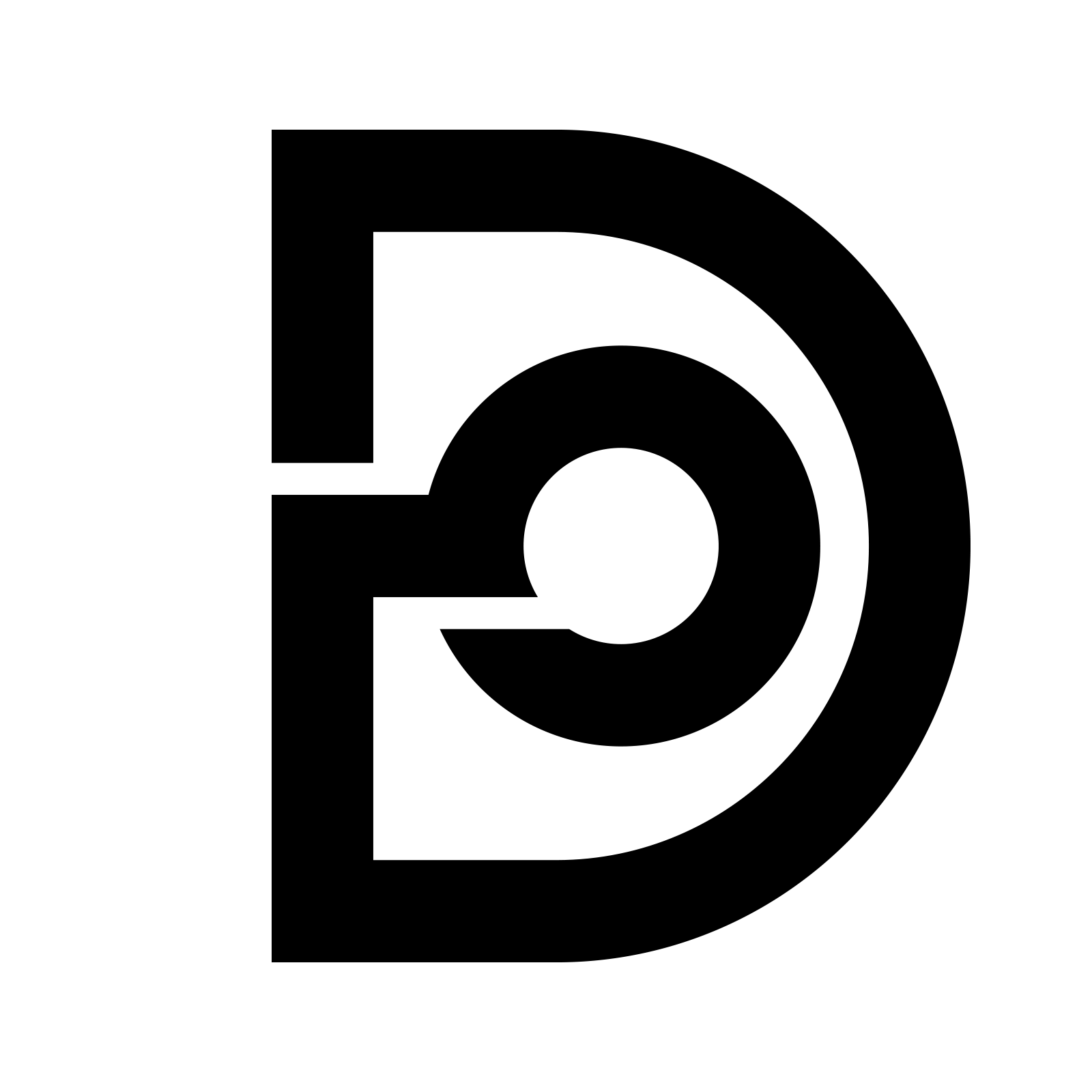Anhaltisches Theater Dessau
Oskar und die Dame in Rosa
Monolog nach dem Roman von Eric-Emmanuel Schmitt
Oskar hat Leukämie und wird bald sterben, obwohl er noch viel zu jung dafür ist. Aber keiner will es ihm sagen, Doktor Düsseldorf nicht und auch nicht seine Eltern. Nur Oma Rosa ist anders, aber das muss sie ja, so als ehemalige Weltmeisterin im Frauencatchen. Oma Rosa kann fluchen wie ein Rohrspatz, ist ehrlich bis zur Unverschämtheit und erzählt Geschichten, dass sich die Balken biegen – kurz, sie ist die beste Dame in Rosa des gesamten Krankenhauses. Und als sie Oskar erzählt, dass Gott jeden Tag einen Wunsch erfüllen kann, fängt er an, ihm Briefe zu schreiben, obwohl er gar nicht an ihn glaubt. (Den Weihnachtsmann gibt es ja schließlich auch nicht!)
Eine rührende, unpathetische Geschichte über eine generationenübergreifende Freundschaft und einen kleinen Jungen, der in zwölf Tagen ein ganzes Leben durchläuft. Erzählt, gelesen und gespielt von Christel Ortmann.